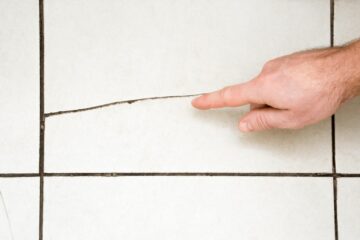Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Unfallversicherung: Anspruchsprüfung und Nachweispflichten im Fokus
- Der Fall vor Gericht
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche medizinischen Nachweise sind für die Anerkennung einer Invalidität durch die private Unfallversicherung erforderlich?
- Welche Fristen müssen bei der Geltendmachung von Invaliditätsansprüchen eingehalten werden?
- Wie wird der Grad der Invalidität nach einem Unfall bestimmt?
- Was kann man tun, wenn die Versicherung die Invalidität nicht anerkennt?
- Welche Bedeutung haben progressive Invaliditätsstaffeln bei der Leistungsberechnung?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Weitere Beiträge zum Thema
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Regensburg
- Datum: 15.11.2023
- Aktenzeichen: 31 O 725/19
- Verfahrensart: Zivilverfahren wegen Invaliditätsleistungen aus Unfallversicherungen
- Rechtsbereiche: Versicherungsrecht, Zivilrecht
Beteiligte Parteien:
- Klägerin: Versicherungsnehmerin, die Invaliditätsleistungen aus zwei privaten Unfallversicherungen beansprucht. Sie behauptet, durch einen Unfall am 10.12.2013 ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten zu haben, das zu dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen und einer Invaliditätsstufe von mindestens 80% führte.
- Beklagte: Versicherungsgesellschaft, die die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche bestreitet. Die Beklagte argumentiert, dass die von der Klägerin behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht auf den Unfall zurückzuführen seien, sondern psychosomatische Ursachen hätten. Zudem bezweifelt die Beklagte die Aktivlegitimation der Klägerin.
Um was ging es?
- Sachverhalt: Die Klägerin fordert invaliditätsbezogene Zahlungen aufgrund eines Unfalls, bei dem sie sich eine Nasenbeinfraktur zuzog, verbunden mit gesundheitlichen Problemen wie Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten. Sie argumentiert, diese Probleme seien auf eine hirnorganische Schädigung durch den Unfall zurückzuführen.
- Kern des Rechtsstreits: Es geht um die Frage, ob die Klägerin durch den Unfall tatsächlich eine hirnorganische Erstverletzung erlitten hat, die die von ihr vorgetragenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen verursachte und ob diese einen Invaliditätsgrad begründen, der Leistungen aus den Unfallversicherungen rechtfertigt.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Die Klage wurde abgewiesen.
- Begründung: Der Klägerin gelang es nicht, den Nachweis zu erbringen, dass ihre behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen hirnorganische Schäden sind, die durch das Unfallereignis verursacht wurden. Die Beweislast für eine Unfallkausalität der Schäden lag bei der Klägerin, welche sie nicht erfüllen konnte. Die gerichtsseitige Untersuchung mit Sachverständigen konnte keine traumatisch bedingten hirnorganischen Schäden feststellen, die auf den Unfall zurückzuführen sind.
- Folgen: Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Unfallversicherung: Anspruchsprüfung und Nachweispflichten im Fokus
Die private Unfallversicherung bietet einen wichtigen Schutz für Versicherte, der insbesondere nach einem Unfall von großer Bedeutung ist. Sie sichert die finanziellen Folgen eines Unfallereignisses ab und unterstützt dabei, die Leistungserbringung schnell und unbürokratisch zu gestalten. Um Anspruch auf die Leistungen der Unfallversicherung zu erheben, ist jedoch ein Nachweis des Unfallereignisses zwingend erforderlich. Dies kann in Form einer Deklaration des Unfalls oder durch die Vorlage eines Invaliditätsnachweises geschehen.
Die Kenntnis über die notwendigen Schritte zur Schadensmeldung und die Einhaltung von Fristen sind entscheidend, um den Versicherungsschutz nach einem Unfall wirksam zu nutzen. Im Folgenden wird ein konkreter Fall betrachtet, der die Herausforderungen und Fragen rund um den Nachweis des Versicherungsfalls sowie die entsprechenden Ansprüche aufzeigt.
Der Fall vor Gericht
Streit um Invaliditätsleistung nach Aufprall gegen Glastür

Eine 1961 geborene Servicemitarbeiterin der U. Bank AG in R. prallte am 10. Dezember 2013 beim Zurückgehen von der Toilette an ihren Arbeitsplatz mit dem Kopf gegen eine geschlossene Glastür. Der Unfall führte zu einer nicht verschobenen Nasenbeinfraktur, einer Contusio nasi sowie einer Schädelprellung. Die Betroffene klagte anschließend über zahlreiche gesundheitliche Beschwerden wie starke Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, kognitive Defizite und Erschöpfungszustände.
Zwei Unfallversicherungen im Fokus
Die Klägerin hatte bei der beklagten Versicherung zwei private Unfallversicherungen abgeschlossen. Die erste Police (Nr. 400…) sah eine Invaliditätsleistung von 25.000 Euro Grundsumme und 250.000 Euro bei Vollinvalidität vor, mit einer progressiven Invaliditätsstaffel von 1000 Prozent. Die zweite Versicherung (Nr. 941…) beinhaltete eine Grundsumme von 250.000 DM und 562.500 DM bei Vollinvalidität, mit einer Progression von 225 Prozent.
Streit um neurologische Schädigung
Die Klägerin machte geltend, durch den Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma mit axonaler Schädigung erlitten zu haben, das zu einem organischen Psychosyndrom geführt habe. Sie forderte Invaliditätsleistungen in Höhe von 175.000 Euro sowie eine monatliche Rente von 1.600 Euro rückwirkend seit Dezember 2013. Die Versicherung bestritt einen hirnorganischen Erstschaden durch den Unfall und vermutete psychosomatische Ursachen für die Beschwerden.
Umfangreiche medizinische Begutachtung
Das Gericht holte mehrere Sachverständigengutachten ein. Während zwei Gutachter zunächst ein Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma diagnostizierten, stützte sich ihre Einschätzung maßgeblich auf ein neuroradiologisches Gutachten von Prof. Dr. Z1., das eine „traumatisch einzuordnende Läsion im linken Marklager“ festgestellt hatte.
Klageabweisung mangels Beweisen
Ein vom Gericht beauftragter Neuroradiologe, Prof. Dr. D., kam jedoch zu dem Schluss, dass die festgestellte Marklagerveränderung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unfallbedingt sei. Die verwendete DTI-Methode sei zudem nicht geeignet, mikrostrukturelle Schädigungen gerichtsfest nachzuweisen. Das Gericht folgte dieser Einschätzung und wies die Klage ab, da die Klägerin nicht nachweisen konnte, dass ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf einer unfallbedingten Hirnschädigung beruhten. Die Kosten des Verfahrens wurden der Klägerin auferlegt.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil verdeutlicht die hohen Beweisanforderungen bei Invaliditätsansprüchen nach einem Unfall: Der Versicherte muss sowohl die unfallbedingte Erstverletzung als auch deren ursächlichen Zusammenhang mit späteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen nachweisen. Besonders bei nicht sofort sichtbaren Verletzungen wie Hirnschäden reichen subjektive Beschwerden allein nicht aus – es bedarf objektiver medizinischer Nachweise direkt nach dem Unfall. Die verwendeten diagnostischen Methoden müssen zudem den aktuellen medizinischen Standards entsprechen und gerichtsfest sein.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Wenn Sie nach einem Unfall Invaliditätsleistungen geltend machen möchten, ist eine umfassende ärztliche Dokumentation unmittelbar nach dem Ereignis entscheidend. Lassen Sie alle Verletzungen und Beschwerden zeitnah von Fachärzten untersuchen und dokumentieren, auch wenn sie zunächst nicht schwerwiegend erscheinen. Bei Kopfverletzungen sollten Sie innerhalb der ersten Tage eine neurologische Untersuchung und bildgebende Verfahren durchführen lassen. Bewahren Sie sämtliche Arztberichte, Befunde und Dokumentationen sorgfältig auf und melden Sie den Schaden fristgerecht ihrer Versicherung. Ziehen Sie bei komplexeren Fällen frühzeitig einen auf Versicherungsrecht spezialisierten Anwalt hinzu.
Benötigen Sie Hilfe?
Die rechtlichen Hürden bei der Durchsetzung von Invaliditätsansprüchen sind komplex und erfordern eine sorgfältige Vorgehensweise – besonders wenn es um nicht sofort erkennbare Verletzungen geht. Unsere erfahrenen Anwälte unterstützen Sie bei der umfassenden Dokumentation Ihrer Ansprüche und kennen die relevanten medizinischen und rechtlichen Anforderungen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre individuellen Erfolgsaussichten prüfen und die optimale Strategie für Ihren Fall entwickeln. ✅ Fordern Sie unsere Ersteinschätzung an!
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche medizinischen Nachweise sind für die Anerkennung einer Invalidität durch die private Unfallversicherung erforderlich?
Für die Anerkennung einer Invalidität durch die private Unfallversicherung ist eine schriftliche ärztliche Feststellung zwingend erforderlich. Diese muss innerhalb der vertraglich festgelegten Frist erfolgen, die in der Regel 15 Monate nach dem Unfall beträgt.
Inhaltliche Anforderungen an die ärztliche Feststellung
Die ärztliche Dokumentation muss einen konkreten, die Arbeitsfähigkeit beeinflussenden Dauerschaden beschreiben. Der Arzt muss dabei die Ursache und die Art der Auswirkungen der Invalidität klar benennen. Eine bloße Behandlungsdokumentation oder mündliche Aussage genügt nicht.
Formale Voraussetzungen
Die Invaliditätsfeststellung muss von einem approbierten Arzt vorgenommen werden. Bescheinigungen von anderen Heilberufen wie Neuropsychologen oder Physiotherapeuten sind nicht ausreichend. Der Arzt muss in seiner schriftlichen Feststellung drei wesentliche Aspekte dokumentieren:
- Eine eindeutige Beschreibung der körperlichen Beeinträchtigung und deren Zusammenhang mit dem konkreten Unfall
- Die Bestätigung der Dauerhaftigkeit der Gesundheitsschäden ohne einschränkende Formulierungen wie „möglicherweise“ oder „eventuell“
- Den zeitlichen Eintritt der Invalidität innerhalb der versicherungsvertraglich vereinbarten Frist
Bedeutung medizinischer Gutachten
Wenn Sie einen Unfall erleiden, der möglicherweise zu einer dauerhaften Beeinträchtigung führt, erstellt in der Regel zunächst Ihr behandelnder Arzt ein Gutachten. Die Versicherung kann zusätzlich ein Gutachten durch einen von ihr beauftragten Spezialisten anfordern. Der Gutachter prüft dabei, ob tatsächlich ein Unfall die Ursache für Ihre Symptome ist und bewertet das Ausmaß des Dauerschadens anhand der sogenannten Gliedertaxe.
Bei der Dokumentation ist besonders wichtig, dass die Schädigung und der betroffene Bereich so umrissen werden, dass der Versicherer bei seiner Leistungsprüfung den medizinischen Bereich klar erkennen kann. Eine bloße Bescheinigung der Invalidität ohne nähere Angaben zu Umfang und Auswirkungen ist nicht ausreichend.
Welche Fristen müssen bei der Geltendmachung von Invaliditätsansprüchen eingehalten werden?
Bei der Geltendmachung von Invaliditätsansprüchen in der privaten Unfallversicherung sind drei wesentliche Fristen zu beachten:
Eintritt der Invalidität
Die Invalidität muss innerhalb von 12 Monaten nach dem Unfall eingetreten sein. In neueren Versicherungsverträgen kann diese Frist auf bis zu 24 Monate verlängert sein. Wenn Sie also einen Unfall erleiden, sollten Sie die Entwicklung Ihrer Gesundheit in diesem Zeitraum genau beobachten.
Ärztliche Feststellung der Invalidität
Ein Arzt muss die Invalidität schriftlich feststellen. Diese Feststellung muss in der Regel innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall erfolgen. Die ärztliche Dokumentation muss dabei konkret die unfallbedingte Gesundheitsschädigung, deren Art und eine Prognose zur Dauerhaftigkeit beinhalten. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Skiunfall – dann sollte Ihr Arzt beispielsweise detailliert beschreiben, welche bleibenden Schäden an Ihrem Knie zu erwarten sind.
Geltendmachung beim Versicherer
Sie müssen Ihren Anspruch auf Invaliditätsleistung innerhalb der vertraglich festgelegten Frist beim Versicherer geltend machen. Diese Frist beträgt üblicherweise ebenfalls 15 Monate nach dem Unfall, kann aber je nach Vertrag variieren. Wenn Sie also feststellen, dass Ihre Verletzung vom Skiunfall nicht vollständig heilt, sollten Sie dies umgehend Ihrer Versicherung mitteilen.
Wichtig: Die genauen Fristen können in Ihrem individuellen Versicherungsvertrag abweichen. Prüfen Sie daher immer Ihre persönlichen Versicherungsbedingungen oder fragen Sie direkt bei Ihrem Versicherer nach.
Bedeutung der Fristen für den Versicherungsschutz
Die Einhaltung dieser Fristen ist entscheidend für Ihren Anspruch auf Invaliditätsleistungen. Versäumen Sie eine dieser Fristen, kann dies zum vollständigen Verlust Ihres Anspruchs führen – selbst wenn tatsächlich eine unfallbedingte Invalidität vorliegt. Der Versicherer ist in der Regel nicht verpflichtet, Leistungen zu erbringen, wenn die Fristen nicht eingehalten wurden.
In einem solchen Fall könnte es passieren, dass Sie trotz erheblicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen keine finanzielle Unterstützung von Ihrer Unfallversicherung erhalten. Stellen Sie sich vor, Sie könnten aufgrund einer verspäteten Meldung die Kosten für notwendige Umbauten in Ihrem Haus nach einem Unfall nicht geltend machen.
Um Ihre Ansprüche zu wahren, sollten Sie nach einem Unfall zeitnah handeln:
- Melden Sie den Unfall unverzüglich Ihrer Versicherung.
- Lassen Sie sich von Ihrem Arzt regelmäßig untersuchen und dokumentieren Sie den Heilungsverlauf.
- Achten Sie auf die Fristen in Ihrem Vertrag und handeln Sie rechtzeitig.
Bedenken Sie: Die sorgfältige Beachtung dieser Fristen kann entscheidend für Ihre finanzielle Absicherung im Falle einer unfallbedingten Invalidität sein.
Wie wird der Grad der Invalidität nach einem Unfall bestimmt?
Der Invaliditätsgrad wird durch ein mehrstufiges Verfahren ermittelt, das auf der Gliedertaxe und einer ärztlichen Begutachtung basiert. Eine Invalidität liegt vor, wenn die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit dauerhaft – das heißt voraussichtlich länger als drei Jahre – beeinträchtigt ist.
Bestimmung anhand der Gliedertaxe
Die Gliedertaxe ordnet jedem Körperteil und Sinnesorgan einen festen Prozentsatz zu. Bei vollständigem Funktionsverlust wird dieser Prozentsatz als Invaliditätsgrad angesetzt. Bei einer nur teilweisen Funktionseinschränkung wird der entsprechende Anteil vom Grundwert berechnet.
Ärztliche Begutachtung
Ein medizinisches Gutachten muss den konkreten Funktionsverlust feststellen. Dabei werden folgende Aspekte berücksichtigt:
- Bewegungseinschränkungen
- Stabilität des Gelenks
- Belastbarkeit im Alltag
- Dauerhafte Schmerzen
Besondere Berechnungsfälle
Bei mehreren verletzten Körperteilen werden die einzelnen Invaliditätsgrade addiert, wobei die Gesamtsumme 100 Prozent nicht übersteigen kann. Sind Körperteile betroffen, die nicht in der Gliedertaxe aufgeführt sind, erfolgt die Bemessung nach medizinischen Gesichtspunkten.
Die Invalidität muss innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall eingetreten und von einem Arzt schriftlich festgestellt worden sein. Die endgültige Entscheidung über den Invaliditätsgrad trifft die Versicherung, die das eingereichte Gutachten prüft oder selbst eine weitere ärztliche Untersuchung veranlassen kann.
Was kann man tun, wenn die Versicherung die Invalidität nicht anerkennt?
Bei Ablehnung der Invaliditätsleistung durch die Unfallversicherung steht Ihnen ein mehrstufiges Rechtsmittelsystem zur Verfügung.
Widerspruchsverfahren als erster Schritt
Ein formloser Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid muss innerhalb eines Monats nach Zugang eingelegt werden. Diesen Widerspruch sollten Sie per Einschreiben an den Versicherer senden. Die Versicherung wird den Sachverhalt daraufhin erneut prüfen.
Medizinische Dokumentation
Die sorgfältige Dokumentation der Unfallfolgen ist entscheidend. Dabei müssen Sie die vertraglichen Fristen einhalten:
- Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten sein
- Eine ärztliche Feststellung muss innerhalb von 15 Monaten erfolgen
- Die Geltendmachung bei der Versicherung muss in dieser Frist erfolgen
Sachverständigenverfahren
Wenn Sie mit der Einschätzung des Versicherungsgutachters nicht einverstanden sind, können Sie ein unabhängiges Sachverständigengutachten einholen. Das Gericht wird in der Regel einen weiteren unabhängigen Gutachter bestimmen, dessen Feststellungen meist ausschlaggebend für das Urteil sind.
Gerichtliches Verfahren
Nach erfolglosem Widerspruch können Sie Klage vor dem zuständigen Gericht erheben. Die Erfolgsaussichten sind dabei nicht zu unterschätzen – statistisch ist etwa jede vierte Klage zumindest teilweise erfolgreich. Die Beweislast für das Vorliegen einer unfallbedingten Invalidität liegt beim Versicherungsnehmer.
Für den konkreten Gesundheitsschaden und seine Dauerhaftigkeit gilt der Vollbeweis nach § 286 ZPO. Für die Ursächlichkeit des unfallbedingten Gesundheitsschadens genügt hingegen die Beweiserleichterung des § 287 ZPO.
Welche Bedeutung haben progressive Invaliditätsstaffeln bei der Leistungsberechnung?
Progressive Invaliditätsstaffeln bewirken eine überproportionale Steigerung der Versicherungsleistung bei höheren Invaliditätsgraden. Wenn Sie eine Unfallversicherung mit Progression abschließen, erhöht sich die Auszahlung mit zunehmendem Invaliditätsgrad deutlich stärker als bei einer linearen Leistungsberechnung.
Funktionsweise der Progression
Die Progression beginnt in der Regel ab einem Invaliditätsgrad von 25 Prozent. Bei einer Versicherungssumme von 100.000 Euro und einem Invaliditätsgrad von 70 Prozent würden Sie ohne Progression 70.000 Euro erhalten. Mit einer Progression von 500 Prozent könnte die Auszahlung hingegen auf bis zu 290.000 Euro steigen.
Typische Progressionsstaffeln
Je nach gewähltem Progressionsmodell gelten unterschiedliche Leistungsstufen:
- Progression 225: Ab 25 Prozent Invalidität verdoppelt sich die Leistung, ab 50 Prozent verdreifacht sie sich
- Progression 350: Ab 25 Prozent verdreifacht sich die Leistung, ab 50 Prozent verfünffacht sie sich
- Progression 500: Ab 25 Prozent verdreifacht sich die Leistung, ab 50 Prozent verachtfacht sie sich
Berechnung der Leistung
Bei der Leistungsberechnung wird der festgestellte Invaliditätsgrad in verschiedene Stufen aufgeteilt. Wenn Sie beispielsweise eine Versicherungssumme von 100.000 Euro mit einer Progression von 225 Prozent vereinbart haben und eine 70-prozentige Invalidität erleiden, setzt sich die Auszahlung wie folgt zusammen:
- Für die ersten 25 Prozent Invalidität: 25.000 Euro
- Für die Invalidität zwischen 25 und 50 Prozent: 50.000 Euro
- Für die Invalidität zwischen 50 und 70 Prozent: 60.000 Euro
Die Gesamtleistung beträgt in diesem Fall 135.000 Euro statt der 70.000 Euro ohne Progression.
Bei mehreren Unfällen wird für die Progression der um die Vorinvalidität geminderte Invaliditätsgrad zugrunde gelegt. Eine Zusammenrechnung verschiedener Unfälle für die progressive Invaliditätsstaffel ist nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Invaliditätsleistung
Eine finanzielle Entschädigung durch die Unfallversicherung, wenn durch einen Unfall eine dauerhafte körperliche oder geistige Beeinträchtigung (Invalidität) entsteht. Die Höhe richtet sich nach dem Grad der Invalidität, der in Prozent angegeben wird. Gemäß § 7 AUB (Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen) muss die Invalidität innerhalb bestimmter Fristen eingetreten und ärztlich festgestellt sein. Beispiel: Bei einem Invaliditätsgrad von 20% und einer Grundversicherungssumme von 100.000€ würden 20.000€ ausgezahlt werden.
Progression
Eine Vereinbarung in der Unfallversicherung, bei der die Invaliditätsleistung überproportional zur Invalidität ansteigt. Bei einer 225%-Progression würde beispielsweise bei einem Invaliditätsgrad von 100% nicht die einfache, sondern die 2,25-fache Versicherungssumme ausgezahlt. Geregelt in § 7 AUB. Dies soll besonders schwere Beeinträchtigungen finanziell besser absichern. Bei einer Grundsumme von 100.000€ würden so bei Vollinvalidität 225.000€ statt 100.000€ gezahlt.
Organisches Psychosyndrom
Eine Störung der Hirnfunktion mit psychischen und neurologischen Symptomen aufgrund einer organischen Schädigung des Gehirns. Typische Symptome sind Konzentrationsstörungen, Gedächtnisprobleme und Persönlichkeitsveränderungen. Rechtlich relevant für die Unfallversicherung nach § 7 AUB, wenn die Schädigung nachweislich durch einen Unfall verursacht wurde. Beispiel: Nach einem Schädel-Hirn-Trauma treten dauerhafte kognitive Einschränkungen und Verhaltensänderungen auf.
Axonale Schädigung
Eine Verletzung der Nervenfasern (Axone) im Gehirn, die Nervenzellen miteinander verbinden. Sie kann durch äußere Gewalteinwirkung wie einen Aufprall entstehen. Nach § 7 AUB relevant für Invaliditätsleistungen, wenn sie unfallbedingt ist und zu dauerhaften Funktionseinschränkungen führt. Die Diagnose erfolgt durch spezielle bildgebende Verfahren. Ein klassisches Beispiel ist die Schädigung durch einen heftigen Aufprall des Kopfes.
Marklagerveränderung
Strukturelle Veränderungen in der weißen Substanz des Gehirns (Marklager), die die Nervenfasern enthält. Im Kontext der Unfallversicherung nach § 7 AUB wichtig für die Beurteilung von Hirnschädigungen. Der Nachweis eines unfallbedingten Zusammenhangs ist oft schwierig, da solche Veränderungen auch andere Ursachen haben können. Beispiel: Sichtbare Veränderungen in der Bildgebung können sowohl unfallbedingt als auch altersbedingt sein.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 286 ZPO: Diese Vorschrift regelt das Beweismaß in der Zivilprozessordnung. Nach § 286 ZPO hat das Gericht seine Überzeugung von der Wahrheit der behaupteten Tatsachen nach freier Überzeugung zu bilden, wobei es den Beweis der Anspruchsvoraussetzungen durch die klagende Partei objektiv zu prüfen hat. Im vorliegenden Fall muss die Klägerin nachweisen, dass sie durch das Unfallereignis eine Gesundheitsbeeinträchtigung erlitten hat und diese eine dauerhafte Einschränkung ihrer Leistungsfähigkeit zur Folge hatte.
- § 287 ZPO: Diese Norm ermöglicht dem Gericht in bestimmten Fällen, Beweisanforderungen zu mildern. Der Kläger muss nur eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die behauptete Kausalität zwischen Erstverletzung und Dauerschaden darlegen, um den Anspruch auf Invaliditätsleistungen geltend zu machen. In diesem Fall ist die Klägerin gefordert, die Kausalität zwischen der erlittenen Verletzung und ihren langfristigen Beschwerden darzustellen, jedoch nicht so streng wie nach § 286 ZPO.
- § 1 Ziffer 1.1 AUB 99: Diese Regelung gehört zu den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen und definiert die Voraussetzungen für die Gewährung von Invaliditätsleistungen. Demnach muss die dauerhafte Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der versicherten Person innerhalb eines Jahres nach dem Unfall von mindestens 50 Prozent festgestellt werden. Die Klägerin muss hiermit belegen, dass ihre Beschwerden die erforderliche Schwere erreichen und die oben genannten Fristen eingehalten wurden.
- § 7 Ziffer I. AUB 88: Diese Bestimmung aus den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen legt ebenfalls fest, dass die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eintreten und ärztlich festgestellt sowie geltend gemacht werden muss. Sie ist relevant für den zweiten Versicherungsvertrag, den die Klägerin abgeschlossen hat. Hier muss die Klägerin sicherstellen, dass ihre Beschwerden innerhalb der vorgegebenen Fristen ärztlich dokumentiert wurden, um ihre Ansprüche auf Invaliditätsleistungen durchzusetzen.
- BGB – § 823: Dieser Paragraph des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt die Schadensersatzpflicht und stellt klar, dass derjenige, der einem anderen vorsätzlich oder fahrlässig einen Schaden zufügt, diesen zu ersetzen hat. Für die Klägerin könnte dies eine Rolle spielen, falls sie den Unfall als Folge eines Dritten sieht, der für das Unfallereignis verantwortlich war. Die Anerkennung eines Schadens könnte auch Auswirkungen auf die Höhe der möglichen Leistungen aus den Unfallversicherungen haben.
Weitere Beiträge zum Thema
- Unfallversicherung: Invalidität nach Knieverletzung nachgewiesen
Ein Fahrradunfall führte zu Knieverletzungen, wobei bereits bestehende Arthrose festgestellt wurde. Das Gericht erkannte nur eine leichte unfallbedingte Beeinträchtigung an, da die Hauptursache auf Verschleißerkrankungen zurückgeführt wurde. Die Forderung nach höheren Zahlungen wurde abgewiesen. → → Knieverletzung und Arthrose: Gericht entscheidet zugunsten der Versicherung - Unfallversicherung: Verjährung von Invaliditätsansprüchen
Eine Versicherungsnehmerin forderte nach einem Sturz höhere Invaliditätsleistungen. Das Gericht stellte fest, dass die Kommunikation während des Neubemessungsverfahrens nicht als Verhandlung über die ursprüngliche Invaliditätsbemessung interpretiert werden kann. Die Ansprüche wurden als verjährt angesehen. → → Verjährung von Ansprüchen bei Invaliditätsklagen - Unfallversicherung: Feststellungsklage nach Ablauf der Erstbemessungsfrist für Invalidität
Ein Kläger forderte nach einem Unfall Invaliditätsleistungen, versäumte jedoch die Fristen für die ärztliche Feststellung und Geltendmachung der Invalidität. Das Gericht wies die Klage ab, da die Voraussetzungen für Invaliditätsleistungen nicht erfüllt waren. → → Fristversäumnis bei der Geltendmachung von Invaliditätsansprüchen - Unfallversicherung: Gericht weist Klage auf Invaliditätsleistung ab
Ein Mann forderte nach einem Auffahrunfall höhere Invaliditätszahlungen. Das Gericht entschied, dass die bestehende Invalidität weitgehend auf vorherige degenerative Veränderungen zurückzuführen sei und wies die Klage ab. → → Klageabweisung aufgrund degenerativer Veränderungen - Unfallversicherung: Zeitpunkt für Bemessung des Invaliditätsgrads bei Rechtsstreit
Nach einem Sturz von einer Leiter forderte ein Versicherungsnehmer eine höhere Invaliditätsentschädigung. Das Gericht entschied, dass für die Bemessung des Invaliditätsgrads der Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der letzten medizinischen Untersuchung vor Ablauf der Dreijahresfrist maßgeblich ist. → → Entscheidende Faktoren für die Invaliditätsbemessung
Das vorliegende Urteil
LG Regensburg – Az.: 31 O 725/19 – Endurteil vom 15.11.2023
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.